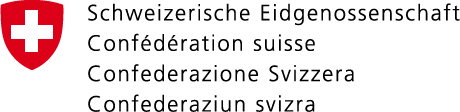Das Abkommen zwischen der Schweiz und Eurojust, der Agentur der EU für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, verstärkt die Zusammenarbeit im Kampf gegen schwere Formen der internationalen Kriminalität. Bei der Verfolgung schwerer grenzüberschreitender und organisierter Kriminalität arbeitet die EU-Agentur mit den nationalen Justizbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten wie der Schweiz zusammen. Dabei nimmt sie vor allem koordinierende Funktionen wahr.
Bei grenzüberschreitender Kriminalität sowie beim organisierten Verbrechen sind die nationalen Strafjustizbehörden in besonderem Mass auf zwischenstaatliche Zusammenarbeit angewiesen. Eurojust trägt dieser Entwicklung Rechnung. 2002 wurde Eurojust als Einheit für justizielle Zusammenarbeit von der EU geschaffen, um die grenzüberschreitende Kooperation der nationalen Justizbehörden bei der Bekämpfung der schweren Kriminalität zu verstärken.
Die Hauptaufgabe von Eurojust liegt in der Koordination. Die EU-Agentur soll als Bindeglied und Vermittlerin die Rahmenbedingungen für eine optimale Zusammenarbeit zwischen den nationalen Strafjustizbehörden schaffen. Sie fördert den Informationsaustausch, erleichtert die internationale Rechtshilfe, organisiert Koordinierungssitzungen u. a. für die Festlegung gemeinsamer Ermittlungsstrategien und leistet einen Beitrag zur Klärung von Zuständigkeitsfragen. Dadurch wird eine effizientere Verfolgung und Ahndung von Straftaten ermöglicht. Dementsprechend nimmt die Bedeutung der EU-Agentur zu.
Eurojust mit Sitz in Den Haag (NL) führt nicht selber Ermittlungen durch und führt auch keine eigenen Strafverfahren. Die EU-Agentur ist also nicht etwa eine europäische Staatsanwaltschaft, sondern wird nur dann unterstützend und koordinierend tätig, wenn sie von nationalen Behörden angefragt wird. In den Zuständigkeitsbereich von Eurojust fallen insbesondere Drogenhandel, Menschenhandel, Terrorismus und dessen Finanzierung, Geldfälschung und Geldwäscherei, Menschenschmuggel, Betrug sowie Umwelt- und Cyberkriminalität.
Eurojust ist das justizielle Pendant zum Europäischen Polizeiamt Europol. Mit Europol arbeitet die Schweiz auf der Grundlage eines Kooperationsabkommens von 2004 zusammen. Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Schweiz und Eurojust ergänzt das Europol-Abkommen und baut die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität konsequent aus.
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Eurojust
Die Zusammenarbeit mit Eurojust wurde 2008 durch das bilaterale Abkommen auf eine vertragliche Grundlage gestellt. Das Abkommen, das die Kooperation mit Eurojust regelt, definiert den Bereich, in dem die beiden Parteien zusammenarbeiten. Für diese Zusammenarbeit wird festgelegt, welche Informationen auf welche Art ausgetauscht werden dürfen. Zudem legt das Abkommen hohe Standards für den Datenschutz fest.
Innerhalb der Strukturen der EU ist Eurojust dem Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zuzuordnen. Jeder EU-Mitgliedstaat entsendet ein nationales Mitglied, meist Staatsanwälte oder Richter. Diese bilden das leitende Kollegium von Eurojust und stellen gleichzeitig die Verbindung zum Justizapparat ihres Staates her. Drittstaaten wie die Schweiz können einen Verbindungsbeamten zu Eurojust entsenden. Die Schweiz entsendet seit 2015 eine Verbindungsstaatsanwältin bzw. einen Verbindungsstaatsanwalt, seit 2018 zusätzlich einen stellvertretenden Verbindungsstaatsanwalt resp. eine stellvertretende Verbindungsstaatsanwältin. Im Abkommen ist ausserdem festgelegt, dass das Bundesamt für Justiz BJ die Funktion der schweizerischen Kontaktstelle im Verhältnis zu Eurojust übernimmt.
Chronologie
2011
- Inkrafttreten des Abkommens (22. Juli)
- Genehmigung durch das Parlament (18. März)
2008
- Unterzeichnung des Abkommens (27. November)