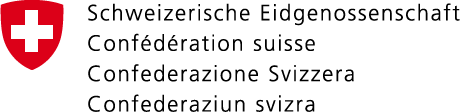Cash and Voucher Assistance (CVA) – Menschen in Krisensituationen ins Zentrum der humanitären Hilfe rücken

CVA ist eine Modalität, um humanitäre Hilfe durch physisches oder digitales Geld oder Gutscheine zu leisten. Menschen, die von Krisen betroffen sind, sind am besten in der Lage, ihre dringendsten Bedürfnisse zu erkennen. Mit CVA haben sie die Wahl und Flexibilität, lebenswichtige Güter zu kaufen und grundlegende Dienstleistungen zu nutzen. Die DEZA setzt CVA sowohl in der Nothilfe als auch in langanhaltenden Krisen ein, und zwar in allen humanitären Sektoren, wie z.B. Nahrungsmittelsicherheit, Unterkunft, Gesundheit, Wasser und Sanitärversorgung sowie Bildung.
DEZA Fokus
Als CVA-Pionierin hat die DEZA seit Ende der 1990er Jahre über 30 Projekte mit einer CVA-Komponente direkt umgesetzt. Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, um die Bedürfnisse ganzer Familien nach einem Wirbelsturm zu decken, oder um nach einem Erdbeben Baumaterialien, die auf lokalen Märkten beschaffen wurden, kaufen zu können, sind nur zwei Beispiele für den Einsatz von CVA durch die DEZA.
Die Schweiz spielt im Bereich CVA drei Schlüsselrollen: Erstens reagiert die DEZA als Akteurin auf Naturereignisse, bewaffnete Konflikte und langwierige Krisen, indem sie eigene Projekte mit einer CVA-Komponente implementiert. Zudem unterstützt sie die CVA-Aktivitäten wichtiger UNO-Partner sowie lokaler und internationaler NGOs durch den Einsatz von Spezialistinnen und Spezialisten des schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH). Zweitens engagiert sich die DEZA als Anwältin aktiv für die systematische Berücksichtigung von CVA und die Einhaltung von Qualitätsstandards. Drittens finanziert die DEZA als Geberin Partnerorganisationen, die Projekte mit einer CVA-Komponente umsetzen.
Nutzung lokaler Märkte und Dienstleistungen in der humanitären Hilfe
Obwohl lebensnotwendige Güter wie Nahrungsmittel und Wasser oft auf lokalen Märkten gekauft werden können, haben Geber und Hilfsorganisationen in der Vergangenheit oft tonnenweise Hilfsgüter aus ihrem eigenen Land in von Krisen betroffene Regionen transportiert. Dies kann negative Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft haben, da lokale Händler mit einem enormen Zustrom kostenloser Waren konfrontiert sind, mit denen sie nicht konkurrieren können.
CVA hingegen ermöglicht es humanitären Akteuren, mit lokalen Märkten zu arbeiten und diese zu unterstützen. Durch die Verlagerung des Einkaufsorts vom globalen zum lokalen Markt können Ladenbesitzer oder lokale Bauern ihre Geschäfte auch in Krisensituationen fortsetzen. Die Nutzung bestehender Dienstleister und die Förderung lokaler Lösungen können auch die Erholung nach einer Krise erleichtern. Schliesslich reduziert CVA oft logistische Kosten, was dazu beiträgt, die angespannte Budgetsituation im humanitären Sektor zu entlasten. Wichtig ist jedoch, dass die lokale Marktwirtschaft mit der erhöhten Nachfrage umgehen kann.
Die sorgfältige Analyse der Marktsituation in der betroffenen Region ist daher ein wesentlicher Bestandteil bei der Beurteilung der Durchführbarkeit von CVA und der Gestaltung erfolgreicher Projekte mit einer CVA-Komponente. Darüber hinaus muss ein zuverlässiges Zahlungssystem vorhanden sein. Am wichtigsten ist jedoch, dass die betroffenen Menschen und Gemeinschaften die Modalität CVA befürworten.
Hintergrund
Der Einsatz von CVA hat in den letzten Jahren rapide zugenommen und ersetzt zunehmend die Verteilung von in-kind distribution (Sachleistungen). Derzeit macht CVA einen Fünftel der internationalen humanitären Hilfe aus. Aber es besteht noch erhebliches Potenzial, den Einsatz von CVA weiter auszubauen. Studien gehen davon aus, dass CVA, wenn es überall dort eingesetzt würde, wo dies machbar und angemessen ist, zwischen 30 und 50% der internationalen humanitären Hilfe ausmachen könnte. Daher setzt sich die DEZA nachdrücklich für den vermehrten Einsatz von CVA in der humanitären Hilfe ein, wobei sie die potenziellen Risiken und Herausforderungen bei der Sicherstellung guter Qualität von Projekten mit einer CVA-Komponente berücksichtigt.
Die DEZA ist Teil des CALP-Netzwerks, das weltweit über 90 Organisationen umfasst. Gemeinsam mit anderen Partnern arbeitet die DEZA daran, das Wissen über den Einsatz von CVA unter humanitären Akteuren zu verbreiten. Sie erforscht auf den Einsatz digitaler Tools und neuer Technologien, um Menschen in Krisen so effizient und effektiv wie möglich zu unterstützen.
Links
Aktuelle Projekte
Keine Suchergebnisse