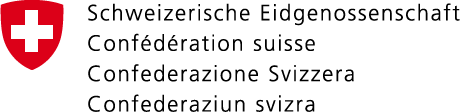Wie die internationale Zusammenarbeit globale Armut und Krisen bekämpft
Alle vier Jahre legt der Bundesrat dem Parlament die Strategie zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) vor. Die Laufzeit 2021–2024 neigt sich dem Ende zu. Zeit für eine Bilanz, um auf die Aktivitäten zurückzublicken und Lehren für die kommende Strategieperiode zu ziehen. Die beteiligten Stellen – die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und die Abteilung Frieden und Menschenrechte (AFM) – tun das im Rechenschaftsbericht.

Die Internationale Zusammenarbeit der Schweiz verbindet eine nachhaltige wirtschaftliche und menschliche Entwicklung mit Frieden und Gouvernanzfragen. © Nabin Baral/IWMI
Die Schweizer IZA hatte sich vier Ziele gesetzt:
- Wirtschaftliche Entwicklung;
- Umwelt;
- Menschliche Entwicklung;
- Frieden und Gouvernanz.
Indem sie diese konsequent verfolgte, trug sie zur Verbesserung der Lebensumstände von Millionen von Menschen bei.
Multiple Krisen wie die Covid-19-Pandemie oder der Krieg gegen die Ukraine prägten die Umsetzung der Strategie. Agilität war gefordert. Dringend benötigte Hilfe musste geleistet werden, ohne dabei die langfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren.
Die Kombination von humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung war notwendig, um nicht nur Krisenbewältigung zu betreiben, sondern langfristig positive Veränderungen zu unterstützen.
Bei der konkreten Umsetzung, also der Wahl der Projekte und Partnerschaften, orientierte sich die IZA-Strategie 2021–2024 erstmals explizit an drei strategischen Kriterien: den Bedürfnissen der Bevölkerung, den Schweizer Interessen und dem Mehrwert der Schweizer IZA. Die Schweizer IZA sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, was sie besonders gut kann, sondern auch dort aktiv sein, wo sie möglichst wirksam ist. Auch die weitere Fokussierung auf Schwerpunktregionen folgte dieser Idee.
Ausgewählte Resultate der internationalen Zusammenarbeit (2020–2022)
- 510 000 Arbeitsplätze geschaffen, erhalten oder verbessert
- 16,2 Millionen Menschen bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt und den Ausstoss von 69 Millionen Tonnen CO2 verhindert
- Über das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe Nothilfe in der Ukraine, der Türkei und Nordsyrien, Haiti oder im Sudan geleistet und den Wiederaufbau nach den Überschwemmungen in Pakistan unterstützt
- Zusammen mit dem IKRK die Staatenallianz «Global Alliance for the Missing» lanciert. Mittlerweile umfasst diese unter dem Vorsitz der Schweiz und Mexikos zwölf Mitgliedstaaten auf fünf Kontinenten. Jeden Tag finden dank ihr 13 Personen ihre Familie.
Die Bilanz für die Jahre 2021–2024
Die Strategie hat sich dank ihrer Expertise, lokalen Verankerung und internationalen Vernetzung insgesamt bewährt. Die Strategie 2025–2028 wird an die neuen Bedürfnisse angepasst, aber in den grossen Linien weitergeführt.
Folgende Lehren sind in die Ausarbeitung der nächsten IZA-Strategie eingeflossen:
- Die Umsetzung der Agenda 2030 braucht mehr Mittel und gezielte Expertise. Die Mobilisierung des Privatsektors spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Diesbezügliche Partnerschaften werden weiter ausgebaut.
- Sowohl die Zahl der fragilen Kontexte als auch die Dauer von humanitären Krisen nehmen zu. Um in diesen Kontexten wirksamere und nachhaltigere Hilfe leisten zu können, müssen die Instrumente der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit zunehmend gemeinsam gedacht werden.
- Lokale Akteure sind vor, während und nach der Laufzeit eines Projektes vor Ort. Sie zu stärken bedeutet, die Nachhaltigkeit der IZA zu erhöhen. Gleichzeitig gilt es, weiter auf eine effiziente Funktionsweise von multilateralen Organisationen und Entwicklungsbanken hinzuwirken.