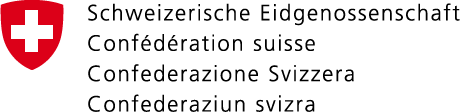Psychische Gesundheit: ein vernachlässigter Bestandteil des Friedens
Trotz der höchsten Anzahl gewaltsamer Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg, erhält das Thema der psychischen Gesundheit nach wie vor unzureichend Beachtung. Dabei ist unbestritten, wie wichtig der Umgang mit psychosozialen Bedürfnissen für einen nachhaltigen Frieden ist. Die DEZA unterstützt Reformen im Gesundheitswesen und lokale Gesundheitsinitiativen in unterschiedlichen Konflikt- und Post-Konflikt-Kontexten. Das Potenzial des psychosozialen Ansatzes zeigt sich deutlich am Beispiel des Engagements in der Ukraine.

Psychologinnen und Psychologen unterstützen im Rahmen von schweizerisch-ukrainischen Projekten vertriebene Menschen in Zentren in der ganzen Ukraine. © DEZA/Alisa Kyrpychova
«Die Ängste nehmen zu, auch die Schlafstörungen. Es gibt Menschen, die aufgrund der heutigen Situation nicht richtig arbeiten oder ein erfülltes Leben führen können. Es kommt zu depressiven Störungen», sagt Tetiana Bohuslavska, die als Psychologin für das schweizerisch-ukrainische Projekt «Act for Health» in der Ukraine tätig ist. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) leidet eine von fünf Personen, die in den vergangenen zehn Jahren einen Krieg oder einen anderen Konflikt erlebt haben, unter Depressionen, Angstzuständen, posttraumatischen Belastungsstörungen, bipolaren Störungen oder Schizophrenie. Die psychische Gesundheit der Bevölkerung ist hingegen unerlässlich für nachhaltigen Frieden. Dabei müssen die unterschiedlichen psychosozialen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Psychische Gesundheit und Frieden
Während psychosoziale Unterstützung in der Vergangenheit kaum in Anspruch genommen wurde, suchen heute Millionen von Menschen in der Ukraine Hilfe, um mit der nun seit Jahren schwer belastenden Situation umzugehen. Tetiana Bohuslavska, die aus ihrer Heimatstadt in der Ostukraine geflüchtet ist, sieht ihre Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit als Beitrag für einen nachhaltigen Frieden. «Für mich sind die Konzepte der psychischen Gesundheit und des Friedens untrennbar miteinander verbunden. Und es geht nicht nur um die Abwesenheit von Krieg, sondern um ein friedliches Umfeld, das vom Krieg betroffene und vertriebene Personen unterstützt.» Aus diesem Grund forderte die UNO jüngst eine stärkere Integration der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Unterstützung (Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS) in die Friedensförderung. Dadurch sollen die Widerstandsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit von Menschen und Gemeinschaften sowie die Voraussetzungen für eine künftige Versöhnung gestärkt werden. Da psychische Belastungen aus wissenschaftlicher Sicht ein wesentliches Hindernis für einen nachhaltigen Frieden und Versöhnung darstellen, behält dieser Ansatz auch über einen Konflikt hinaus seine Bedeutung.
Wegweisende Reform in der Ukraine
Der Umgang mit den oft unsichtbaren Narben des Kriegs ist von entscheidender Bedeutung für die Ukraine. Massive Bombardierungen und Zerstörung, Gewalt, Familientrennungen, Vertreibung, Verlust von Angehörigen und Ungewissheit stellen eine enorme psychische Belastung für die ukrainische Bevölkerung dar. Obwohl sich das ganze Ausmass erst mit der Zeit zeigen wird, geht die WHO in der Ukraine bereits heute von 9,6 Millionen Menschen mit psychischen Problemen aus. Im Bewusstsein um die möglicherweise verheerenden Auswirkungen für die gesamte Gesellschaft legt die ukrainische Regierung ein besonderes Augenmerk auf das psychosoziale Wohlbefinden und die Resilienz der Bevölkerung. Sie hat die psychische Gesundheit bereits 2014 zu einer landesweiten Priorität erklärt.
Die DEZA ergänzt und unterstützt in der Ukraine systemische Bemühungen mit nachhaltiger Wirkung und baut dabei auf ihre weltweiten Erfahrungen auf. Das 2018 lancierte schweizerisch-ukrainische Projekt «Mental Health for Ukraine» unterstützt die Reform der psychiatrischen Versorgung in der Ukraine und die Einrichtung von regionalen Zentren für psychische Gesundheit. Es arbeitet eng mit den ukrainischen Behörden, der Ukrainischen Katholischen Universität sowie Schweizer Expertinnen und Experten für psychische Gesundheit der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und der Universität Zürich zusammen. Das Projekt wurde kürzlich bis 2028 verlängert, wobei Anpassungen an den sich rasch verändernden Kontext und die zunehmenden psychosozialen Bedürfnisse vorgenommen wurden. Wichtige neue Prioritäten sind die Wiedereingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, psychosoziale Unterstützung für Menschen in Grenzgebieten und für Binnenvertriebene, sowie eine bessere Koordination unter den Anbietern psychischer Gesundheitsdienste.
«Die psychische Gesundheit ist sehr wichtig, aber auch äusserst gefährdet, namentlich in Kriegszeiten. Wir müssen eines Tages nicht nur die Infrastruktur und die Städte in der Ukraine wiederaufbauen, sondern auch unsere seelische Gesundheit und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Alles, was wir heute unternehmen, um mit den Folgen von Krieg, Stress und Trauma fertig zu werden, wird zur Heilung und zur Wiederherstellung des Friedens beitragen», erklärt Orest Suvalo, Psychiater und Leiter des Projekts «Mental Health for Ukraine».

Lokale Lösungen für mehr Resilienz
An fünf Tagen in der Woche besucht Tetiana Bohuslavska mit einem mobilen medizinischen Team abgelegene Dörfer und Zentren für vertriebene Menschen. Ihre Arbeit ist Teil des Projekts «Act for Health», das mit dem nationalen Aktionsplan abgestimmt ist und das Projekt «Mental Health for Ukraine» ergänzt. Gemeinsam tragen sie dazu bei, Lücken in der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu schliessen und die psychosozialen Dienste näher zu den Menschen zu bringen. Während die Ärztinnen und Ärzte medizinische Untersuchungen durchführen, bietet Tetiana Bohuslavska private psychosoziale Beratungen an.
«Dieser moderne Ansatz sollte neben biologischen Aspekten auch seelische und soziale Aspekte der Gesundheit berücksichtigen: einen gesunden Körper, psychisches Wohlbefinden und gesellschaftliche Integration. Psychosoziale Dienste sind heute sehr gefragt. Wir verwenden das Recovery-Modell, welches nicht einfach eine vollständige Behandlung oder Genesung anstrebt. Vielmehr geht es darum, dass die Betroffenen lernen, ein erfülltes Leben mit ihrer Erkrankung oder den gegebenen Umständen zu führen», erklärt Tetiana Bohuslavska.

Die lokalen Kapazitäten müssen gestärkt werden, um nachhaltige und flexible Systeme aufzubauen. Das Universitätsspital Genf bringt bei Bedarf Schweizer Fachwissen ein. Um die Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und psychische Gesundheit auf lokaler Ebene zu verbessern, werden im Rahmen des Projekts «Act for Health» vier regionale Wissenszentren für nicht übertragbare Krankheiten, darunter auch psychische Erkrankungen, eingerichtet. Dadurch werden nachhaltige und gleichzeitig flexible Strukturen sowie Fachwissen für die Erbringung psychosozialer Dienste gefördert.
Initiativen in anderen Ländern und globale Fürsprache

Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, die nationale Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit unterstützen, namentlich in der Ukraine, in Bosnien und Herzegowina, in Moldau und in der Region der Grossen Seen. Gleichzeitig setzt sie sich im Rahmen des globalen politischen Dialogs für die Verbesserung der psychischen Gesundheit ein.
Mit der «Sonderinitiative für psychische Gesundheit» der WHO soll der Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen lokal getragenen psychosozialen Diensten verbessert werden. Seit der Lancierung im Jahr 2019 unterstützt die Initiative die Politik im Bereich der psychischen Gesundheit, die Interessenvertretung und die Menschenrechte. Zudem wurden Interventionen in 9 Ländern unterstützt, darunter Bangladesch, Nepal und Simbabwe. Bis heute konnten 44,7 Millionen Menschen davon profitieren. Die Folgen der Covid-19-Pandemie haben das Interesse weiterer Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geweckt.
Die auf Länderebene gesammelten Erkenntnisse werden für die normative Arbeit auf globaler Ebene verwendet, zum Beispiel für den Atlas zur psychischen Gesundheit 2019/2020, das «Mental Health Gap Action Programme 2023» oder den Weltbericht zur psychischen Gesundheit 2022.
Bosnien und Herzegowina

In Bosnien und Herzegowina leiden viele Menschen unter psychischen Störungen, die durch kriegsbedingte seelische Verletzungen sowie soziale und wirtschaftliche Probleme verursacht werden. Das Projekt zur Förderung der psychischen Gesundheit, das 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde, unterstützte die Reform der psychischen Gesundheitsversorgung im Land seit 2009. Das Projekt wurde von einer lokalen Partnerorganisation in enger Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und den initiierenden Gesundheitsbehörden der Entitäten durchgeführt.
Der Fokus lag auf der Dezentralisierung der Leistungserbringung von den Spitälern hin zu gemeindenahen Dienstleistungszentren (Community Mental Health Centres, CMHCs) und dem Aufbau eines Netzes von 74 solcher Zentren mit multidisziplinären Teams. Die Mehrheit wird heute vollständig aus den öffentlichen Gesundheitsbudgets finanziert und beabsichtigt, ihre Arbeit fortzusetzen.
Grosse Seen

Die Region der Grossen Seen war seit der Kolonialzeit immer wieder Schauplatz gewaltsamer Konflikte. Die DEZA fördert in Burundi, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo einen gemeindenahen Ansatz (Healing Together), der sich mit dem Kreislauf der Gewalt befasst, einschliesslich der geschlechtsspezifischen Gewalt als Folge der Konflikte. Auf Ebene des politischen Dialogs sind nicht nur Botschaften zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zentral, sondern auch die Einhaltung der in der Erklärung von Kampala eingegangenen Verpflichtungen, namentlich die Aufnahme des Healing-Together-Ansatzes in Politik und Strategien. Dies führt langfristig zu einer Verringerung von Gewalt, zur Wiederherstellung gemeinsamer Werte in der Gemeinschaft und zu einem besseren sozialen Zusammenhalt – Voraussetzungen für einen nachhaltigen Frieden.
Lateinamerika

Trotz beträchtlicher makroökonomischer Fortschritte, bleiben anhaltende Konflikte, Gewalt, Fragilität und grosse Ungleichheiten Stolpersteine für die nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika. Vor diesem Hintergrund entschied sich das Kooperationsbüro der DEZA in Honduras, den psychosozialen Ansatz in allen Projekten zu verankern. Denn die langanhaltenden Konflikte und die endemische Gewalt hatten zu einer Kultur der Angst und der kollektiven Traumata geführt – mit negativen Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung. Der Ansatz verbindet persönliche (Gefühle, Überzeugungen, Werte), soziale (Kultur, Beziehungen) und materielle Aspekte (Armut, natürliche und strukturelle Bedingungen) und hat zum Ziel, eine Kultur der Gewalt, Polarisierung und soziale Konflikte zu überwinden, indem der soziale Zusammenhalt und die Befähigung der Zivilgesellschaft und der Gemeinschaften gestärkt werden.