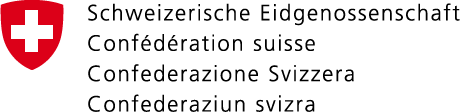Ziel 1: Leben retten und den Zugang zu einer guten Grundversorgung unterstützen
Zur Grundversorgung gehören insbesondere die sanitäre Infrastruktur, medizinische Grundleistungen, der Zugang zu Bildung und eine soziale Absicherung. Die Massnahmen der IZA zielen darauf ab, den Zugang, die Qualität und die Abdeckung dieser Versorgung zu verbessern, unabhängig davon, ob sie durch staatliche oder private Akteure bereitgestellt wird. Die Verbesserung von Dienstleistungen wie jener im Bildungs- und Gesundheitswesen schafft die notwendigen Voraussetzungen für den Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten, die zu nachhaltigen Arbeitsplätzen und einem aktiven öffentlichen Leben führen.
In Krisen- und Konfliktsituationen ist die Grundversorgung häufig nicht mehr gewährleistet. Mit ihrem Einsatz im Bereich der humanitären Hilfe trägt die IZA der Schweiz dazu bei, dass gefährdete Personen und Bevölkerungsgruppen ihre Grundbedürfnisse decken können. Die IZA realisiert bilaterale und multilaterale Initiativen, um die Einhaltung und Umsetzung des humanitären Völkerrechts und der humanitären Prinzipien in Konfliktgebieten zu fördern und zum Schutz der Zivilbevölkerung beizutragen. Über ihre IZA-Aktivitäten setzt sich die Schweiz überdies bei den beteiligten Akteuren für die Einhaltung der humanitären Prinzipien ein.
Aufgrund des aktuellen Kontexts legt die Strategie 2025–2028 den Schwerpunkt im Bereich menschliche Entwicklung auf zwei spezifische Ziele: Migration und Gesundheit.