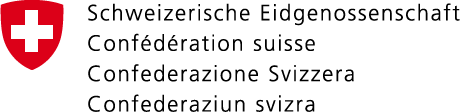Die Achtung, der Schutz sowie die Förderung und Weiterentwicklung der Menschenrechte sind Grundpfeiler der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Durch ihr Engagement konnte die Schweiz 2017 zur Verbesserung der Menschenrechtslage beitragen, so beispielsweise auch im asiatischen Raum.
Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern
-

Schulung von Menschenrechtsverantwortlichen aus allen regionalen und subregionalen Büros der Nationalen Menschenrechtskommission im Jahr 2017, Kathmandu, Nepal. Die Ausbildner verwenden häufig Fallbeispiele aus der Zeit des Konflikts. © DEZA
-

Mitglieder der Nationalen Menschenrechtskommission (NHRC) nahmen 2017 an einer Weiterbildung in Leadership und Management im Dhulikhel Mountain Resort teil. © DEZA
-

NHRC-Focal-Points erhielten im März 2017 eine Weiterbildung in Compliance-Monitoring durch den Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte (ICCPR). © DEZA
Förderung der Menschenrechte und der Aufbau eines dauerhaften Friedens in Nepal
Nepal hat in den letzten zehn Jahren bei den Menschenrechten vielversprechende Fortschritte gemacht: Friedensabkommen 2006, neue Verfassung 2015, Einrichtung von zwei unabhängigen Untersuchungskommissionen zu Menschenrechtsverletzungen während des Konflikts und Beitritt zum Menschenrechtsrat 2017. Dieses Engagement trägt wesentlich zu einem dauerhaften Frieden und einer inklusiven Gesellschaft bei, beides Voraussetzungen für menschenwürdige Lebensbedingungen der Bevölkerung.
Die DEZA begleitet Nepal in diesem Prozess, indem sie die nationale Menschenrechtskommission unterstützt. Seit sich das Land für eine föderale Struktur entschieden hat, befindet sich die Kommission in einer entscheidenden Phase. Für die DEZA stellt die Förderung der Menschenrechte eine Priorität dar, insbesondere in fragilen Kontexten und Konflikten. Ein langfristiges Engagement ist entscheidend, um den Frieden zu festigen und staatliche Strukturen aufzubauen. Ansonsten steigt das Risiko für neue Gewaltausbrüche, für einen Zerfall der Institutionen oder für humanitäre Krisen, was gleichzeitig das Entwicklungspotenzial des Landes gefährdet.
Schlüsselakteurin
«Wenn die Verantwortlichen für den Tod meiner Tochter vor Gericht gestellt und verurteilt werden, wird mein Kampf den Familien anderer Opfer Mut machen.» Diese Worte eines Vaters zeigen, wie wichtig die Unterstützung der Kommission für den Zugang zur Justiz für verwundbare Bevölkerungsgruppen ist. Diese unabhängige Kommission ist eine Schlüsselakteurin innerhalb der Menschenrechtsarchitektur Nepals. Sie konfrontiert die nepalesische Regierung mit ihren Unterlassungen und fordert sie mittels Empfehlungen dazu auf, ihre Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem Land wahrzunehmen. Die Arbeit der Kommission umfasst beispielsweise die Untersuchung von Fällen, wo Menschen während des Konflikts verschwanden. . Die Kommission fordert die Regierung auf, die Verantwortlichen vor ein Gericht zu stellen und die Familien der Opfer zu entschädigen. Dieser Prozess ist für die Trauerarbeit in den Familien und für die nationale Versöhnung unerlässlich.
Erfreuliche Ergebnisse
In Zusammenarbeit mit anderen Agenturen unterstützt die DEZA seit 2001 die Arbeit der Kommission, damit die nepalesische Bevölkerung ihre Rechte wahrnehmen kann. Neben fachlicher Unterstützung fördert die DEZA auch die Ausbildung der Kommissionsmitglieder und den Austausch mit anderen Institutionen. Die eingereichten Klagen haben zwischen 2016 und 2017 erfreulicherweise um 40% zugenommen. Die meisten Fälle führten zu einer Untersuchung. Die Fälle, bei denen eine Einigung durch Versöhnung zustande kam, nahmen um mehr als einen Drittel zu. Die Kommission hat aber immer noch Mühe, Regierung und Parlament von ihren Empfehlungen zu überzeugen.
Übergang zu einem föderalen System
Mit den Wahlen in den Gemeinden, Provinzen und auf nationaler Ebene im Jahr 2017 hat Nepal den Weg eines föderalen Systems eingeschlagen. Die Arbeit der acht von der Kommission eingerichteten Regionalbüros kommen den Begünstigten zugute. Die Herausforderung der Kommission besteht darin, ihre Struktur an die neuen rechtlichen Bedingungen anzupassen, obwohl diese noch nicht klar definiert sind. Zudem muss sie eine gute Zusammenarbeit mit den neuen Behörden sicherstellen und gleichzeitig die wachsenden Bedürfnisse auf regionaler und lokaler Ebene befriedigen.
Bessere Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Das SECO hat sich 2017 dafür ausgesprochen, in den kommenden vier Jahren das Programm «Better Work» weiter zu unterstützen.
«Better Work» berät und trainiert Unternehmen, die Kleider und Textilien exportieren. Das Ziel besteht darin, dass die Unternehmen ihre Arbeitsbedingungen verbessern sowie nationale Arbeitsgesetze und internationale Arbeitsnormen einhalten. An der Entwicklung von Lösungen sind auch Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligt, ebenso wie Regierungsvertreter, internationale Organisationen und Markenunternehmen, welche die Kleider und Textilien einkaufen.
Zwei Millionen Menschen profitieren
«Better Work» wird derzeit in 1500 Fabriken in Bangladesch, Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Jordanien, Nicaragua und Haiti umgesetzt. Die Fabriken beschäftigen zusammen mehr als zwei Millionen Menschen.
In den betroffenen Unternehmen gibt es deutlich weniger Fälle von Zwangsarbeit, Geschlechterdiskriminierung und sexueller Belästigung. Gleichzeitig führen die besseren Arbeitsbedingungen dazu, dass die Produktion um bis zu 22% gesteigert wird und die Arbeiterinnen und Arbeiter besser bezahlt werden. So bringen sie bis zu 33% mehr Geld in ihre Familien. Ausserdem versetzt «Better Work» die Unternehmen in die Lage, die Anforderungen der Einkäuferfirmen zu erfüllen und im globalen Handel zu bestehen.
Mehr und bessere Arbeitsplätze
«Better Work» wird von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO realisiert. Die Schweiz unterstützt das Programm seit 2007. Nun wird das Engagement in Asien – insbesondere in den Partnerländern Indonesien und Vietnam – bis 2021 mit 12 Millionen CHF weitergeführt.
Prävention häuslicher Gewalt in Tadschikistan

Die Schweiz unterstützt Tadschikistan bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt. Dies wird erreicht, indem rechtliche Reformen unterstützt und landesweit Sensibilisierungskampagnen durchgeführt werden.
Etwa 70% der Frauen in Tadschikistan wurden im Laufe ihres Lebens bereits Opfer häuslicher Gewalt. Grund dafür ist vor allem ein konservatives Rollenbild der Geschlechter. Die Polizei und die Justiz stellen sich ebenfalls meist auf die Seite der Familie des Ehemannes und schützen Opfer häuslicher Gewalt zu wenig. Die Schweiz setzt sich deshalb im Rahmen des Projekts «Prävention häuslicher Gewalt» dafür ein, dass die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert wird. Zudem werden auf lokaler und nationaler Ebene Rahmenbedingungen geschaffen, welche sowohl Täter zur Rechenschaft ziehen als auch Opfer besser schützen und unterstützen.
Bereits seit 1999 ist die DEZA in Tadschikistan in diesem Bereich tätig und kann bis heute gute Resultate vorweisen. Auch dank Schweizer Unterstützung wurde 2013 das Gesetz zur Prävention häuslicher Gewalt verabschiedet. Bereits mehr als 4000 Opfer haben in den durch ein Partnerprojekt finanzierten Krisenzentren psychologische und juristische Unterstützung erhalten. Seit 2013 wurden mehr als 95% der Gerichtsfälle zugunsten der Opfer häuslicher Gewalt entschieden. Das Bewusstsein der Bevölkerung über verschiedene Formen häuslicher Gewalt hat ebenfalls deutlich zugenommen, von 36,6% (2009) auf 60,9% (2015).