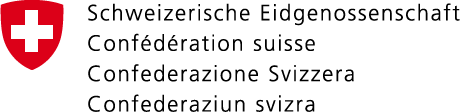Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz setzt sich für Rechtsstaatlichkeit und solide Institutionen ein. Gemeinsam mit zivilen und staatlichen Akteuren sowie mit multilateralen Organisationen konnten 2017 positive Ergebnisse erzielt werden. Gezieltes Training der lokalen Bevölkerung und des Personals von grossen Organisationen in den Bereichen Klimawandel, Energie-Infrastruktur oder Wasser-Verwaltung stärkte die Rolle der Zivilbevölkerung in verschiedenen Länder.
Rechtsstaat, Demokratie und Institutionen stärken

Bürgerinnen und Bürger gestalten aktiv die Zukunft ihres Landes
Eine aktive Zivilgesellschaft ist zentral für eine funktionierende und stabile Demokratie. Sie sorgt dafür, dass die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung vertreten werden. Zudem verfolgt sie die Tätigkeiten der Regierung, und verpflichtet sie zu Transparenz und Rechenschaftsablegung. Damit fördert eine aktive Zivilgesellschaft sozialen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum. Gerade in jungen Demokratien – wie zum Beispiel in den Staaten des Westbalkans – gibt es Hürden, die es der Zivilgesellschaft erschweren, ihre Interessen und Bedürfnisse einzubringen. Gründe dafür sind eingeschränkte Pressefreiheit, weitverbreitete Korruption oder politische und soziale Ausgrenzung von Minderheiten.
In den beiden Westbalkan-Staaten Mazedonien und Kosovo gilt es noch einige Herausforderungen zu meistern. Die öffentlich wahrgenommene Korruption ist hoch und die Presse- und Meinungsfreiheit ist nicht gewährleistet. Im Rahmen zweier Projekte in Mazedonien und im Kosovo unterstützt die Schweiz direkt rund 200 zivilgesellschaftliche Organisationen und Akteure, die sich für einen sozialen Wandel in ihren Ländern einsetzen. Ziel ist es ihre Anliegen effektiver in den politischen Prozess einzubringen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Dialog anzuregen. Im Folgenden werden zwei Beispiele von zivilgesellschaftlichen Initiativen vorgestellt, welche die DEZA in Mazedonien und im Kosovo unterstützt:
Bürgerinnen und Bürger bewirken in Mazedonien politischen Wandel
2016 regte sich landesweit Widerstand gegen die damalige mazedonische Regierung. Bürgerinnen und Bürger waren unzufrieden mit dem politischen Kurs, welche die Regierung einschlug. Anhaltspunkte, die Regierung sei in einen Korruptionsskandal verwickelt, verschärften die Situation. Die Leute trugen ihren Unmut auf die Strasse, womit die «farbige Revolution» ihren Anfang nahm. Dies führte zu Neuwahlen und schliesslich zu einem friedlichen Regierungswechsel in Mazedonien. Von der DEZA unterstützte Organisationen setzten sich dabei aktiv für die Aufklärung des Korruptionsskandals ein, sowie für die Ausarbeitung eines Vorschlags, wie man die politische Krise lösen könnte.
Keine wirksame Hilfe ohne Demokratisierung
Kosovarische Erfolgsgeschichten regen den Austausch unter den Bürgern an
Die Internetplattform AlbInfo informiert die Bevölkerung im Westbalkan sowie die albanischsprachige Diaspora in der Schweiz über aktuelle Themen aus dem Westbalkan. Die DEZA finanziert eine Serie von Reportagen über persönliche Erfolgsgeschichten von Kosovarinnen und Kosovaren. Ob Modedesignerin, Bio-Landwirt oder Bauunternehmer – die Geschichten fördern die Vernetzung zwischen der Diaspora und der Region und stärken den Austausch von Wissen und Erfahrung auch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern.
Kostenlose Online-Kurse für einen effizienten Umgang mit dem Klimawandel

Damit sich die Gesellschaft an die Erderwärmung anpassen kann, braucht es fundiertes Wissen zum Thema Klimawandel und gezielte Ausbildungsmassnahmen. Oft haben jene Menschen, die von den Auswirkungen der globalen Erwärmung am stärksten betroffen sind, keinen Zugang zu Wissen und einschlägiger Bildung. UN CC:Learn bietet entsprechende Lösungen.
Damit sich die Gesellschaft insgesamt mit den Gefahren der Erderwärmung auseinandersetzen kann, braucht es fundiertes Wissen zum Thema Klimawandel und gezielte Ausbildungsmassnahmen. Oft haben jene Menschen, die von den Auswirkungen der globalen Erwärmung am stärksten betroffen sind, keinen Zugang zu Wissen und einschlägiger Bildung. Die Initiative UN CC:Learn bietet hier entsprechende Lösungen. Auf der Online-Plattform steht für alle und überall ein kostenloser E-Learning-Kurs zum Thema Klimawandel zur Verfügung. 2017 erreichte die Plattform gleich zwei Meilensteine: 100’000 Benutzerinnen und Benutzer in 195 UNO-Ländern waren registriert und 10’000 Zertifikate wurden an erfolgreiche Kursabsolventinnen und -absolventen ausgestellt.
UN CC:Learn - Lernen, mit dem Klimawandel zu leben
Weltweit steigt das Bewusstsein über die Folgen des Klimawandels. Aber nur wenige verfügen über das Wissen und die Fähigkeit, sich anzupassen und die Auswirkungen zu vermindern. Die sechs Module von UN CC:Learn erklären, wie Technologie und Politik die Treibhausgasemissionen reduzieren können. Sie zeigen, wie man sich an den Klimawandel anpassen und wie man finanzielle Unterstützung beantragen kann, und sie erläutern die wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klimawandel. Dank dem E-Learning-Kurs haben Menschen aus der ganzen Welt ein besseres Verständnis des Phänomens Klimawandel und sind in der Lage, für sich geeignete Lösungen zu entwickeln. Die Plattform dient dem Kapazitätsaufbau von Personen und Institutionen und gilt als wichtigster internationaler Mechanismus zur Steigerung des Klimabewusstseins gemäss dem Klimaübereinkommen der UNO (Action for Climate Empowerment, ACE).
Die Initiative vermittelt einerseits jungen Menschen Wissen zur globalen Erwärmung und unterstützt andererseits Regierungen bei der Erarbeitung und Umsetzung von nationalen Lernstrategien zum Thema Klimawandel. Das Projekt UN CC:Learn wird von der DEZA finanziell unterstützt und von UNITAR, dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen, durchgeführt. Es ist ein Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klima-Übereinkommens und ermutigt und befähigt alle Menschen, mitzuhelfen.
Energie für eine abgelegene Bergregion

Pamir Energy ist ein vom SECO unterstütztes Elektrizitätswerk in der tadschikischen Provinz Berg-Badachschan. Es versorgt über eine Viertelmillion Menschen zuverlässig, nachhaltig und bezahlbar mit Energie aus Wasserkraft.
Pamir Energy stellt in der tadschikischen Provinz 220‘000 Menschen Strom zur Verfügung, das sind 96% der dort lebenden Bevölkerung. Dazu kommen 35'000 Menschen jenseits der Grenze in Afghanistan. In den letzten Jahren hat das Unternehmen elf Wasserkraftwerke und rund 4300 Kilometer Leitungen instandgesetzt. Das Leben der Menschen und die wirtschaftlichen Möglichkeiten verändern sich damit grundlegend. Es gibt Licht, man kann ohne Feuer kochen, lokales Gewerbe siedelt sich an.
Strom bezahlen mit dem Handy
Elektrischer Strom rund um die Uhr – das ist neu in dieser entlegenen und unwirtlichen Region, in der vielfältige Naturgefahren lauern, in der es im Winter bis zu minus 50 Grad kalt wird und wo es Dörfer gibt, die weit über 3000 Meter über Meer liegen.
Für diese Dienstleistung zu bezahlen ist in diesem ehemals sowjetischen Gebiet keine Selbstverständlichkeit. Pamir Energy rüstet darum jeden Kunden mit einem individuellen Stromzähler aus. 33'000 digitale Messgeräte machen den Verbrauch und die Kosten transparent und schaffen so Vertrauen. Die Kunden erhalten die monatliche Strom-Rechnung aufs Handy zugestellt – und können sie auch per Handy begleichen.
Internationale Anerkennung
Pamir Energy ist 2017 mit dem «Ashden Award» ausgezeichnet worden. Dieser renommierte internationale Preis zeichnet erfolgreiche Projekte im Bereich der nachhaltigen Energiegewinnung aus.
Pamir Energy wird seit 2002 im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft betrieben. Neben der Regierung von Tadschikistan und dem SECO beteiligen sich der «Aga Khan Fund for Economic Development», die «International Finance Corporation» und die «International Development Association» am Projekt.
Nachhaltiges länderübergreifendes Wassermanagement im Mekongbecken

Der Mekong ist für über sechzig Millionen Menschen eine unentbehrliche Lebensquelle, namentlich im südlichen Flussverlauf. Das Mekongdelta ist die Reiskammer einer ganzen Region, hier findet man eine einzigartige biologische Vielfalt und enorme Wasserressourcen.
Der Mekong ist auch der Motor der gesamten lokalen Wasserkraftindustrie, die zwar zur Entwicklung der Region beiträgt, aber auch deren natürliches Gleichgewicht destabilisiert. Der Bau zahlreicher Staudämme im Mekong hat den Wasserhaushalt des Flusses verändert, was sich auf die Ernährungssicherheit der Bevölkerung auswirkt und potenzielle Konflikte schürt. Die Folgen des Klimawandels – Dürre und Überschwemmungen – verschärfen die Lage zusätzlich.
Um sich den grenzüberschreitenden Herausforderungen zu stellen und um ein integriertes Wasserressourcenmanagement zu ermöglichen, haben die Länder des unteren Mekongbeckens (Laos, Kambodscha, Thailand und Vietnam) die Mekong River Commission gegründet. Seit 1995 ermöglicht diese Kommission, namentlich mit der Unterstützung der Schweiz, den Dialog und die Transparenz zwischen allen betroffenen Staaten, einschliesslich China und Myanmar, und fördert den Aufbau von Wissen über die Bedrohungen des Mekong.
Bei der Projektierung des Wasserkraftwerks Pak Beng im Norden von Laos koordinierte die Mekong River Commission beispielsweise die Abklärungen über die Auswirkungen des grenzüberschreitenden Wassermanagements, um die Risiken im Zusammenhang mit schwankenden Wasserständen zu senken oder zu eliminieren. Die Kommission fungiert ausserdem als Kompetenzzentrum für technische Belange wie die Einführung eines Hochwasserwarnsystems oder das Monitoring der Wasserqualität. Beide Projekte wurden von der Schweiz mitfinanziert.