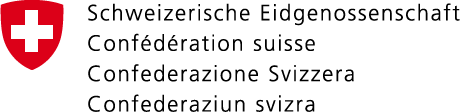Mit Krisen, Katastrophen und Fragilität umgehen
Der Schutz und die Unterstützung von Opfern humanitärer Krisen und Katastrophen ist eine Priorität der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Ihr Engagement konzentriert sich dabei insbesondere auf fragile Kontexte. Das Verhältnis zwischen Hunger und Konflikten, die Reduktion von Ernteausfällen sowie die Überwindung gesellschaftlicher Traumata waren bedeutende Arbeitsbereiche der DEZA im Jahr 2017.

Hungersnöte nehmen wieder zu
Nigeria, Südsudan, Somalia und Jemen standen 2017 vor einer Hungersnot. Rund 20 Millionen Menschen waren von Ernährungsunsicherheit betroffen, die auf bewaffnete Konflikte und das Klimaphänomen «El Niño» zurückzuführen ist. Die DEZA war in diesen vier Ländern bereits vor der Hungersnot aktiv und stellte 2017 zusätzliche Mittel bereit, um die Nothilfe und die Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit zu verstärken.
Über 30 Jahre lang schien der internationale Kampf gegen Hunger Früchte zu tragen. Die Erreichung des nachhaltigen Entwicklungsziels «Zero Hunger» lag in den letzten Jahren näher als je zuvor. Doch seit 2016 steigt die Zahl der Hungernden wieder an: Heute leiden 815 Millionen Menschen weltweit an Hunger und alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangel- oder Unterernährung.
Neben extremen Wetterereignissen wie Dürren gelten insbesondere bewaffnete Konflikte als Hauptursache für diesen seit 2016 erstmaligen Wiederanstieg des Hungers weltweit. Hunger und Konflikt verstärken sich gegenseitig.
Ausbau der laufenden Aktivitäten
2017 drohten bewaffnete Konflikte auch in Nigeria, Somalia, im Südsudan und Jemen eine Hungerkrise von noch nie dagewesenen Ausmass auszulösen. Die Schweiz reagierte umgehend auf den Appell des UNO-Generalsekretärs vom Februar 2017 und stellte zusätzlich 15 Millionen CHF für humanitäre Nothilfe in der Hungerkrise zur Verfügung. Die Mittel ermöglichten den Aufbau von besseren Existenzgrundlagen der Bevölkerung und deren Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Ein Teil der Summe diente auch der Unterstützung von Einsätzen des IKRK sowie von UNO-Organisationen, wie dem Welternährungsprogramm (WFP) und dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, die hungernden Menschen auf der Flucht helfen. Ausserdem unterstützt die Schweiz bereits seit 2015 humanitäre Aktivitäten in der Tschadsee-Region, seit 2013 setzt sie ein regionales Programm am Horn von Afrika um.
Die internationale Reaktion konnte eine schwere Hungersnot vorerst verhindern. Allerdings werfen andauernde kriegerische Handlungen, ungünstige Wetterbedingungen und schwache Regierungsstrukturen die betroffenen Länder ständig zurück. Infolgedessen bleibt es eine immense Herausforderung, Hungerkrisen abzuwenden. Dies bedingt stetige Anpassungen der Hilfsleistungen, auch derjenigen der Schweiz. Sie ist weltweit mit sechs Millionen CHF jährlich die grösste Geldgeberin im Nothilfefonds des WFP. Die Mittel können innerhalb von 24 Stunden nach Ausbruch einer Krise für die betroffene Bevölkerung eingesetzt werden. Dies erlaubte in Somalia die Versorgung von mehr als einer Million gefährdeter Mütter und Kinder mit 4000 Tonnen Spezialnahrung. 2017 förderte die Schweiz den vermehrten Einsatz von Transferzahlungen (Bargeld oder Gutscheine), um besser auf die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung eingehen zu können. Allein in den letzten zwei Jahren unterstützten 17 Fachkräfte des Schweizerischen Korps‘ für Humanitäre Hilfe das WFP mit ihrer Expertise.
Humanitäre Hilfe: nur ein Teil der Lösung
Akute Hungerkrisen bedingen rasche Nothilfe. Nothilfe allein wird dem Hunger auf der Welt und seinen Ursachen aber kein Ende setzen. Aus diesem Grund wendet die Schweiz ihre humanitären sowie entwicklungs- und friedenspolitischen Instrumente im Kampf gegen den Hunger gleichzeitig an, um damit gefährdete Menschen noch besser zu schützen. Sie fördert landwirtschaftliche Beratungsdienste im Südsudan, bereitet Nigeria mit Partnerorganisationen auf kommende Trockenzeiten vor oder bietet dem Jemen eine Plattform für Friedensgespräche.
Einzig Frieden, das heisst eine politische Lösung , kann Hunger vollends bekämpfen. Trotz Rückschlägen liegt auch heute das nachhaltige Entwicklungsziel «Zero Hunger» durchaus im Bereich des Möglichen.
Südliches Afrika: Stärkung der ländlichen Resilienz

«Nur 10 anstatt wie in guten Jahren 130 Säcke Mais habe ich letztes Jahr geerntet!», beklagt sich Boyd Mungalu, einer von Millionen sambischen Kleinbauern. Im von Dürren heimgesuchten südlichen Afrika leiden 25 Millionen Menschen unter Ernährungsunsicherheit und chronischer Fehlernährung.
Risikoreduktion durch verbesserte und ressourcenschonende Landwirtschaft
Risikotransfer durch Zugang zu einer Ernteversicherung
Risikostreuung durch Diversifizierung und Zugang zu Mikrokrediten; und Sparen für den Notfall
Die DEZA unterstützt die Region mit zwei komplementären Ansätzen: der erste richtet sich direkt an die Kleinbauern, der zweite an Entscheidungsträger der Länder und der regionalen Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC).
Die innovative «R4 Initiative» (siehe Bild) lädt Kleinbauern in Malawi, Sambia und Zimbabwe zum differenzierten Risikomanagement ein:
Die «R4 Initiative» verbindet lokale, private Mikrofinanz- und Versicherungsinstitutionen mit Regierungen, internationalen Versicherungsfirmen (z.B. Swiss Re) und Entwicklungsagenturen. Seit Boyd Mungalu dieser Initiative beigetreten ist, bescheren ihm der Anbau von vielfältigen, trockenresistenten Getreidearten und bodenschonende Methoden eine sichere Ernte.
Die Initiative zur Bewertung und Analyse der regionalen Vulnerabilität unterstützt die Mitgliedstaaten der SADC in der Verbesserung von Präventionsmassnahmen, der Linderung während und der Erholung nach Katastrophenereignissen. Durch das DEZA-Projekt gestärkt loten nationale Komitees systematisch die Schwachstellen ihrer Länder bezüglich Fehlernährung, Armut, HIV und Umweltzerstörung aus. Diese Analysen leiten auf nationaler und regionaler Ebene die Erarbeitung von Notfall- und Entwicklungsplänen für eine schnellere und gezieltere Hilfestellung für Notleidende ein.
Kunst als verbindende Sprache

Insbesondere in Ländern, die einen Konflikt zu überwinden haben, können Kunst und Kultur helfen, Wunden in der Gesellschaft zu heilen. Die DEZA unterstützt kulturelle Projekte in Regionen, die mit den Folgen von Konflikten kämpfen. Zu den unterstützten Projekten gehört das Ubumuntu Arts Festival in Ruanda, das im Genocide Memorial Centre in Kigali stattfand und Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zusammenbrachte.
Zu den unterstützten Projekten gehört das Ubumuntu Arts Festival in Kastentext 2 Ruanda, das im Genocide Memorial Centre in Kigali stattfand und Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt zusammenbrachte. Auf dem Programm standen Performances, Workshops und Podiumsgespräche. Für Hope Azeda, Gründerin und Kuratorin des Festivals, baut Kunst Brücken, ermöglicht einen konkreten Dialog und widerspiegelt das wahre Leben.
Was war der primäre Zweck des Ubumuntu Arts Festival?
Das Festival war einerseits eine Plattform für die öffentliche Auseinandersetzung mit Themen rund um die soziale Gerechtigkeit und trug andererseits zur Befähigung der Gemeinschaften bei. Es fokussierte auf menschliche Werte und förderte mittels Kunst den Austausch zu heiklen Themen. Ausserdem wollen wir Raum für Künstlerinnen und Künstler schaffen, damit sie ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, sich vernetzen und kreativ sein können.
Kann Kunst nach Konflikten Gräben überbrücken?
Die Gespräche können bisweilen schwierig sein, weil sie Erinnerungen hervorrufen und die Wunden noch frisch sind. Ich wuchs als Flüchtling in Uganda auf. Als ich zurück nach Ruanda kam, wirkte die Gesellschaft wie ein zerbrochener Spiegel. Ich denke, nach Konflikten kann Kunst verbinden, Kunst baut Brücken. Sie regt zum Nachdenken über das Leben an und motiviert die Menschen, die Bruchstücke wieder zusammenzufügen.
Was braucht es , um das künstlerische Schaffen in Ruanda weiter zu professionalisieren?
In Ruanda fehlt eine Kunstschule. Eine Kunstausbildung fördert das kritische Denken der Kunstschaffenden. Sie können lernen, wie sie mit heiklen Themen professionell umgehen und wie sie sich in der Gesellschaft frei mitteilen können.
Flüchtlingkrise von Myanmar

Bis Ende 2017 hatte Bangladesch 650’000 Menschen aufgenommen, die vor der Gewalt in Myanmar geflohen sind. Die Menschen fanden im Grenzgebiet Cox’s Bazar Schutz. Sie haben alles zurückgelassen und sind völlig mittellos. Zahlreiche Kinder haben ihre Eltern verloren. 2017 stellte die DEZA acht Millionen Franken zur Unterstützung der Rohingyas bereit. Dank dem humanitären Engagement haben die Flüchtlinge Zugang zu Trinkwasser, Nahrung und sanitären Einrichtungen.
Es konnten auch Unterkünfte für die vielen Schutzsuchenden aufgestellt werden. Die Humanitäre Hilfe der DEZA lieferte Diagnoseausrüstungen und Geräte, um die Aufnahmekapazitäten in zwei Spitälern in der Region Cox’s Bazar zu erhöhen. Fünf Expertinnen und Experten des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe unterstützen die UNO-Organisationen. In Anbetracht des Ausmasses der Krise, die wohl noch lange andauern dürfte, und ihrer Auswirkungen auf die Gastgemeinschaften wird die DEZA ihr humanitäres Engagement mit langfristig ausgerichteten Entwicklungsmassnahmen ergänzen, namentlich um der Gastbevölkerung zu helfen.
Auf der anderen Seite der Grenze hat die DEZA trotz eingeschränktem Zugang weiterhin Beiträge an humanitäre Aktivitäten im myanmarischen Bundesstaat Rakhine geleistet.