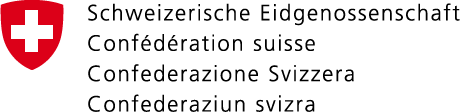Das Engagement der Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit zielt auf gemeinsames und verantwortungsvolles Handeln der Staatengemeinschaft ab. Um ihre Ziele auf globaler Ebeneumzusetzen, arbeitet die Schweiz eng mit multilateralen Organisationen wie der UNO oder der Weltbank zusammen. Die nachhaltige und länderübergreifende Wasserbewirtschaftung war im Jahr 2017 ein zentraler Aspekt der globalen Zusammenarbeit der Schweiz.
Globale Herausforderungen bewältigen

Gemeinsames Kapitel für die nachhaltige Entwicklung
In ihrem Bestreben die UNO effizienter zu machen, gelang es der Schweiz im Jahr 2017 die vier wichtigsten Entwicklungsagenturen zu einer engeren Zusammenarbeit zu verpflichten. Dank ihrem internationalen Engagement und ihrer weltweit anerkannten Expertise überzeugte die Schweiz in Verhandlungen die 193 UNO-Mitgliedstaaten von der dafür nötigen Strategieanpassung. In Zukunft müssen darum das Entwicklungsprogramm (UNDP), das Kinderhilfswerk (UNICEF), die Agentur für die Rechte der Frauen (UN Women) und der Bevölkerungsfonds (UNFPA) gemeinsam darlegen, wie sie ihre Aktivitäten strategisch planen und zugunsten der Agenda 2030 umsetzen.
Agenda 2030
Alle Staats- und Regierungschefs der Welt haben 2015 in der UNO die Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SGDs) einstimmig verabschiedet. Dies ist die bahnbrechendste Entwicklungsagenda der Welt, denn sie enthält ein radikales Versprechen an alle Menschen: niemanden zurückzulassen. Sie enthält Ziele wie beispielsweise Armut in allen Formen und überall zu beenden (SDG1), Geschlechtergleichstellung zu erreichen (SDG 5) oder nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern (SDG 12).
Die Agenda 2030 hat zum Ziel jene Menschen zu erreichen die bislang am wenigsten von der Globalisierung und der fortschreitenden Entwicklung profitieren konnten. Die DEZA setzt sich mit ihrer Einflussnahme in der UNO für die Anliegen genau dieser Menschen ein.
Bessere Hilfe dank gemeinsamer Planung
Eine bessere Koordination und aufeinander abgestimmte Einsätze der UNO vor Ort sind das Resultat des Schweizer Engagements. Bedürftige Menschen erhalten somit umfassendere und effektivere Hilfe.
Ein gemeinsames Kapitel in den neuen strategischen Plänen der vier UNO Agenturen hält den Entscheid zur engeren Zusammenarbeit fest. Das gemeinsame Kapitel erläutert, wie die Entwicklungsagenturen in den sechs für die Schweiz prioritären Bereichen der Agenda 2030 handeln sollen.
Sechs Prioritäten der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit:
Bekämpfung extremer Armut
Klimawandel und Umgang mit Naturkatastrophen
Krisenbewältigung
Gesundheitsversorgung von Jugendlichen, Frauen und Mädchen
Gleichstellung von Frau und Mann
gemeinsame Datenerhebung zur Situation von benachteiligten Menschen
Gemeinsame Verantwortung – gemeinsame Ziele
Eine solche strategische Organisation ist beispielhaft. Sie verankert die optimale Nutzung von Expertise und Synergien der UNDP, UNICEF, UN Women und UNFPA, um den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung weltweit zum Durchbruch zu verhelfen.
Dieser Erfolg ist für die Schweiz von Bedeutung, weil das gemeinsame Kapitel, die Effizienz und Kohärenz der UNO in der Umsetzung der Agenda 2030 fördert. Die Schweiz trägt damit zu einer starken UNO bei, die mit ihrem weltweit einzigartigen Mandat alle Länder in der nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Davon profitiert auch die Schweiz, um ihre nationalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.
Trinkwasser im Flüchtlingslager

Jordanien hat 600’000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Azraq ist das zweitgrösste Flüchtlingslager im Lande. Die Humanitäre Hilfe der DEZA hat hier in Zusammenarbeit mit UNICEF eine Wasserversorgungsanlage gebaut. Sie ermöglicht Tausenden Familien einen direkten Zugang zu Trinkwasser.
Mit rund 35’000 syrischen Flüchtlingen ist Azraq das zweitgrösste Flüchtlingslager in Jordanien. Es liegt in einer Wüstenebene neunzig Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Das Lager kann maximal 55’000 Menschen aufnehmen. Angesichts der glühenden Hitze im Sommer 2017 erwies sich ein gesicherter Zugang zu Trinkwasser für die Bewohnerinnen und Bewohner als prioritär. Zu Beginn transportierten 40 bis 50 Tankwagen laufend Wasser von einer 50km entfernten Quelle heran. Weil die Zahl der im Lager wohnenden Flüchtlinge stets anstieg, musste dringend eine effizientere und günstigere Lösung gefunden werden, um den Zugang zu Trinkwasser zu gewährleisten.
Trinkwasser bis in die Unterkünfte
Das Kinderhilfswerk UNICEF leitet sämtliche Aktivitäten im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung im Lager von Azraq. Im Herbst 2015 antwortete die Humanitäre Hilfe der DEZA auf einen Appell der UNICEF zum Bau einer Wasserversorgungsanlage innerhalb des Flüchtlingslagers. Mehrere Experten für Wasser und sanitäre Versorgung des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) sind in Jordanien im Einsatz, um das Projekt umzusetzen. Mit einer zweiten Bohrung in unmittelbarer Nähe des Lagers wurde rasch eine zweite Versorgungsquelle erschlossen und die Abhängigkeit von einer einzigen Quelle behoben. Schliesslich wurden Leitungsrohre mit einer Gesamtlänge von 35km verlegt und 214 Wasserhähne installiert, um das Lager an die beiden Quellen anzuschliessen. Darüber hinaus wurden lokale Fachkräfte ausgebildet, um die Wartung der Anlage sicherzustellen.
Einsparungen zugunsten der Bildung
Im Mai 2017 wurden die Tankwagen durch die neue Anlage abgelöst, die eine unterbrechungsfreie Versorgung der Flüchtlinge mit Trinkwasser sicherstellt. Durch den Wegfall der Tankwagen kann pro Jahr eine Million CHF an Transportkosten eingespart werden. Dieser Betrag kann fortan für Bildungsprogramme zugunsten der Flüchtlinge eingesetzt werden.
«Blue Peace» in Zentralasien

Die Schweiz setzt sich mit ihrem «blauen Diplomatie»-Ansatz in Zentralasien für Dialog und Kooperation in der regionalen Wasserbewirtschaftung ein.
In der Region Zentralasien gibt es viele ungelöste Konflikte. Neben umstrittenen Grenzverläufen führt die konkurrenzierende Nutzung von gemeinsamen Wasserressourcen immer wieder zu Spannungen. Doch 2017 einigten sich die fünf zentralasiatischen Staaten auf Richtlinien für einen gemeinsamen Dialog über die Wassernutzung. Hinter dieser Einigung steht die «Blue Peace Central Asia Initiative» der DEZA. Blue Peace zielt darauf ab, den nachhaltigen Umgang mit Wasser über Ländergrenzen hinweg zu regeln. Denn eine gemeinsame Verwaltung der Wasserressourcen hat das Potential, in der Region Stabilität, Sicherheit und Wachstum zu schaffen.
Im Rahmen der Weltausstellung im Juni 2017 in Astana trafen sich auf Einladung der DEZA die fünf Staaten Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Im Zentrum dieses Blue-Peace-Treffens, an dem auch Altbundesrat Didier Burkhalter teilnahm, standen Fragen rund ums Thema Wasser.
Die Schweiz ist dank ihrer Expertise in der Wasserbewirtschaftung und ihrem langjährigen Engagement in der Region ein vertrauenswürdiger und geschätzter Partner. Sie brachte Experten mit an den Verhandlungstisch, welche halfen, bewährte Lösungen an den zentralasiatischen Kontext anzupassen. Die verabschiedeten Richtlinien sehen die Schaffung einer Plattform für die regionale politische Zusammenarbeit betreffend Wasserfragen vor. Damit wurde der Grundstein für die zukünftige Zusammenarbeit und ein friedliches Miteinander in der Region gelegt.
Die Schweiz bekennt sich zum Multilateralismus

Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums ihres Beitritts zur Weltbank organisierte die Schweiz eine Konferenz mit Weltbank-Präsident Jim Yong Kim und Bundesrat Johann N. Schneider-Amman.
1992 stimmte die Schweizer Bevölkerung mit rund 56% Ja-Stimmen dem Beitritt zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank zu. Die Schweiz ist bis heute das einzige Land, das sich den Bretton-Woods-Institutionen per Volksabstimmung angeschlossen hat.
Weltbank setzt sich für Nachhaltigkeitsziele ein
Die Jubiläumskonferenz im August 2017 in Bern thematisierte die Erfolge und Herausforderungen der Weltbank im vergangenen Vierteljahrhundert. Die Teilnehmenden befassten sich insbesondere mit der Frage, wie die Bank dazu beitragen kann, die UNO-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die weltweite Armut zu reduzieren. Sie erörterten zudem, wie die Schweiz ihre Partnerschaft mit der Weltbank zukünftig ausrichten und wie sie zu den geplanten Kapitalerhöhungen der beiden Weltbank-Organisationen IBRD (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) und IFC (Internationale Finanzkorporation) beitragen kann.
Entwicklungsbanken sind für die Schweiz zentral
Die Schweiz nutzte die Jubiläumskonferenz, um sich zum Multilateralismus zu bekennen. Die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsbanken, insbesondere mit der Weltbank, ist ein zentraler Teil des Schweizer Entwicklungsengagements und eine wichtige Ergänzung zu den bilateralen Aktivitäten. Die Weltbank verfügt über eine kritische Grösse. Dies ist wichtig, um globale Herausforderungen wie Finanzkrisen, Klimawandel, Umweltkatastrophen, Migrationsströme oder Epidemien zu bewältigen.
Rückführung illegal erworbener Gelder im Sinne der Armutsbekämpfung

Rund 321 Millionen USD Potentaten-Gelder aus der Entourage des ehemaligen Diktators Sani Abacha werden von der Schweiz an Nigeria zurückgeführt.
Die illegal erworbenen Millionen werden nicht bedingungslos zurückgegeben, sondern unter Aufsicht der Weltbank direkt in ein ambitioniertes Projekt überwiesen. Dieses baut das erste nationale Sozialversicherungssystem Nigerias auf. Die Modalitäten der Rückführung sind in einem Abkommen festgelegt, welches von der Schweiz, Nigeria und der Weltbank am 4. Dezember 2017 in Washington D.C. im Rahmen des «Global Forum on Asset Recovery» unterzeichnet wurde.
Die Rückführung kommt unmittelbar der nigerianischen Bevölkerung zugute. Konkret profitieren sozial-benachteiligte Familien in Form von monatlichen Cash-Transfers in der Höhe von 25 USD pro Monat, oder bis zu 50 USD pro Monat, falls Bedingungen wie etwa Alphabetisierungskurse, Gesundheits-Checks für Kinder oder Impfungen erfüllt werden. Ganz im Sinne der Schweizer Rückführungspolitik regelt das Abkommen sowohl die Einbindung der nigerianischen Zivilgesellschaft in das Projekt-Monitoring als auch Massnahmen im Falle von Missbrauch und Korruption.
«Die explizite Verwendung der Gelder für die ärmsten Schichten der Gesellschaft verleiht der Restitution Vorbildcharakter» sagt Pio Wennubst, Vize-Direktor der DEZA. Zudem sei der Fall ein konkreter Lösungsansatz im Kontext der internationalen Entwicklungsfinanzierung. Denn die Möglichkeit, illegal erworbene Gelder in Projekte zu investieren, welche der nachhaltigen Entwicklung und dem Wohl der Zivilbevölkerung im Herkunftsland zuträglich sind, entsprechen international anerkannten Restitutionsprinzipien. Mit diesem Fall konnte die Schweiz neue internationale Standards setzen, die für künftige Restitutionsfälle weltweit als Referenz dienen können.