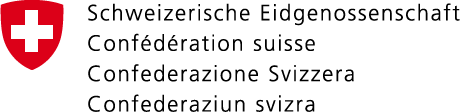Migration hat viele Gesichter. Sicherheit, Arbeit und die Suche nach einer besseren Zukunft sind Gründe für das Verlassen der Heimat für Millionen von Menschen. Die Schweiz setzte sich 2017 für eine sichere und legale Migration ein.
Migration im Fokus

Von Batticaloa nach New York: Persönliche und globale Lösungen zusammenführen für eine sichere und reguläre Migration
Während ihr Ehemann in Katar arbeitet, sorgt Sevanthy für ihre drei Kinder. Sie leben im Osten Sri Lankas. Nur dank dem Geld, das er nach Hause schickt, können sie die Schule bezahlen und ihre Grundbedürfnisse decken. Dank dem von der DEZA finanzierten Programm für sichere Arbeitsmigration konnte Sevanthy an einem Kurs finanzielle Grundkenntnisse erwerben, um das Geld besser zu verwalten, das sie monatlich erhält. Vor dem Kurs fiel ihr dies sehr schwer. Nun kann sie Ausgabenprioritäten setzen und ein Budget erstellen.
Diese Initiative wurde in Sri Lanka im Jahr 2013 lanciert. Sie ist Teil einer Gesamtstrategie der DEZA, die darauf abzielt, die Arbeitsmigration zur Entwicklung der Länder und ihrer Gemeinden zu nutzen und dafür zu sorgen, dass niemand zurückgelassen wird.
Aufklärung und faire Rahmenbedingungen
Für viele Menschen in Sri Lanka sind Jobs im Ausland, vor allem im Nahen Osten, die einzige Möglichkeit, den Familienunterhalt zu finanzieren. Aber eine Arbeit im Ausland ist mit vielen Hürden verbunden, namentlich für gering qualifizierte Arbeitskräfte und ihre zurückbleibenden Familien. Die DEZA hilft Menschen, die auswandern müssen, ihre Rechte und Pflichten zu verstehen und mit schwierigen Situationen am Arbeitsplatz im Ausland und bei der Rückkehr zurechtzukommen. Die zurückgebliebenen Familien werden unterstützt, um die Abwesenheit von Vater oder Mutter zu überwinden und das Geld aus dem Ausland sinnvoll zu verwalten. Rekrutierungsprozesse werden transparenter gestaltet und an internationale Standards angepasst.
Von persönlichen Erfahrungen zu globalen Lösungen
Trotz anhaltender Probleme ist es der DEZA gelungen, Regierungen, Privatsektor, Arbeitgeber und Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen, um die Situation der Migrationsarbeiterinnen und -arbeiter sowie deren Familien zu verbessern. Ihre Arbeit mit Einzelpersonen, Bezirken und Regierungen ist Teil eines regionalen Prozesses im Nahen Osten und in Südostasien. An regionalen Dialogen diskutieren nationale Regierungen darüber, wie die Arbeitsmigration zur nachhaltigen Entwicklung beitragen kann.
Persönliche Erfahrungen und Geschichten verschmelzen mit den globalen Anstrengungen, einen gemeinsamen Rahmen für eine Migrationsgouvernanz zu erarbeiten. Bestrebungen sind im Gange für die Schaffung eines globalen Pakts für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (GCM). Die Schweiz unterstützt diesen Prozess, da er Teil ihrer Bemühungen zur Reduktion von Ungleichheiten im Rahmen der Umsetzung der Agenda 2030 (SDG 10) ist. Die Arbeit des GCM umfasst neben Bestandesaufnahmen auch Verhandlungen.
Die Realität von Batticaloa, einem kleinen Dorf in Sri Lanka, in dem Sevanthy lebt, an den Verhandlungstisch in New York zu bringen, bedeutet, dass Erfahrungen auf allen Ebenen in den Global Compact on Migration einfliessen. Gerade die Erfahrungen von gewöhnlichen Menschen machen die Bedeutung des Globalen Pakts aus und machen ihn zugänglich für alle.
Arbeitsmigration – menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen
Mobilität: ein Entwicklungsfaktor

Die Bevölkerungsgruppen in Westafrika gehören seit jeher zu den mobilsten der Welt, wobei sie sich hauptsächlich innerhalb ihrer Region bewegen. «In Westafrika stellt die Mobilität schon lange einen Entwicklungsfaktor dar. Die DEZA orientiert ihre Aktivitäten hauptsächlich an dieser zirkulären Migration, um den freien Personen- und Güterverkehr in der Region sicherzustellen», erklärt Chantal Nicod, Chefin der Abteilung Westafrika.
Die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit im Dienst der Bevölkerung
Die DEZA fördert den wirtschaftlichen Aufschwung und Möglichkeiten zugunsten der Mobilität und der regionalen Integration durch regional zugeschnittene Programme. Indem sie die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit unterstützt, trägt sie zu einem besseren Zugang der Bevölkerung zu Grunddienstleistungen und Infrastrukturen bei. Mit Berufsperspektiven für junge Menschen in einer Region mit hohem Bevölkerungswachstum, der Förderung der lokalen Wirtschaft sowie der Stärkung von Bürgerbewusstsein, Toleranz und Frieden wird den Ursachen der Migration begegnet. Dank den Bildungsprogrammen für die Bevölkerungsgruppen, welche von der nomadischen Viehwirtschaft leben, erhielten 10’000 nomadische Viehzüchter eine Grundausbildung und 2000 eine Berufsausbildung. Darunter war ein Drittel Frauen. Die DEZA trägt mit der Sicherung der Transitkorridore für die Herden auch zur Verringerung der Konflikte zwischen nomadischen und sesshaften Bevölkerungsgruppen in den Grenzgebieten bei. Sie bringt ihre Erfahrungen vor Ort auf nationaler, regionaler und globaler Ebene ein und nährt so die Suche nach politischen Lösungen für die Migrationsfragen aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung. Sie unterstützt unter anderem die nationale Migrationspolitik von Burkina Faso, Nigeria und Benin und von der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS).
Der Niger im Brennpunkt der Migrationsproblematik
Als Knotenpunkt der Migrationsrouten zwischen Subsahara-Afrika und dem Maghreb ist der Niger besonders mit der Migrationsproblematik konfrontiert. Zwischen Oktober 2016 und Mai 2017 durchquerten über 130’000 Menschen die Region Agadez. Wegen den wiederholten Angriffen der Extremistengruppe Boko Haram nahm der Niger auch viele Vertriebene auf. Die DEZA unterstützt ein Projekt der italienischen NGO COOPI, das den Opfern psychosoziale Unterstützung und Schutz bietet. Zum besseren Verständnis des Phänomens und der Problematik der Migration für die Entwicklung hat die DEZA eine Dialoggruppe gebildet, an der Geber, Forschende, die Zivilgesellschaft und die nigrische Regierung zusammenkommen. Sie finanziert zudem Studien einer Forschergruppe der Universität von Niamey, Niger, die verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der Migration untersucht, namentlich: Rückkehr, Wiedereingliederung und Bewegungen der Migrantinnen und Migranten, Sicherheitsfragen und regionale Integration, Frauenmigration und Zusammenhänge zwischen Migration, Armut und Klimawandel.
Das SECO eröffnet Perspektiven
Das SECO eröffnet den Menschen in seinen Partnerländern wirtschaftliche Perspektiven, damit sie sich nicht zum Auswandern gezwungen sehen. Es unterstützt dazu Programme, die das Unternehmertum fördern und die Fachkompetenzen von Jobsuchenden stärken. Zudem ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu langfristigem Kapital und verbessert ihr Geschäftsumfeld. Das SECO arbeitet damit langfristig an den strukturellen Ursachen von Migration.
Bewährt ist der «SECO-Start-up-Fund»: dieser gewährt Investoren mit Schweizer Wohnsitz Darlehen bis zu 500‘000 CHF, um erfolgversprechende privatwirtschaftliche Projekte in Entwicklungsländern zu lancieren. Die Darlehen dürfen dabei maximal 50% der Investitionen ausmachen und müssen in fünf Jahren zurückgezahlt werden. Seit dem Start 1998 bis Ende 2017 finanzierte der SECO-Start-up-Fund knapp 130 Darlehen in 34 Ländern in der Höhe von insgesamt über 36 Millionen Franken. Dabei kann man davon ausgehen, dass ein Franken aus dem Start-up-Fund weitere Investitionen in der Höhe von 10 CHF auslöst.
Ein weiterer SECO-Schwerpunkt ist es, die Fachkompetenzen von Arbeitnehmenden in Partnerländern zu stärken. Gut ausgebildete Mitarbeitende sind besser in den Arbeitsmarkt integriert und machen ihre Unternehmen wettbewerbsfähiger. In Ägypten, Tunesien, Marokko und Jordanien unterstützt das SECO seit Ende 2017 beispielsweise das «Economic Inclusion Programm» der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Das Programm unterstützt den Privatsektor darin, massgeschneiderte Ausbildungsprogramme zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Unternehmen orientieren. Das Programm zielt insbesondere darauf ab, jene Bevölkerungsgruppen einzubinden, die am meisten von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Das sind unter anderem junge Erwachsene, Frauen sowie Menschen aus benachteiligten Landesregionen.