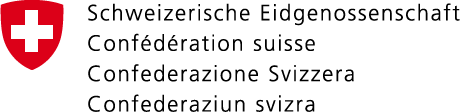«Nie wieder», hatten wir gerufen. Jahr für Jahr werden wir am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust an die Gräueltaten erinnert, die wir nur zu gerne hinter uns gelassen hätten. Heute jedoch lebt der Antisemitismus von Europa bis Australien wieder mit einer Wucht und Sichtbarkeit auf, die viele für längst vergangen hielten. Ein weiteres, alarmierendes Zeichen für die Brüche in der heutigen Welt.
Die Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel und der darauffolgende Krieg in Gaza haben diesen gefährlichen Trend noch verschärft. Leider bleibt auch unser Land nicht verschont, wie ein neuer Übergriff Anfang dieser Woche in Zürich zeigt. Im Jahr 2024 verzeichnete die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus 221 antisemitische Vorfälle – 42,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu gehörten eine verheerende Messerattacke, ein versuchter Brandanschlag sowie explizite körperliche und verbale Angriffe. Hinzu kommt die Zunahme von Gewalt in unserem öffentlichen Raum vergangenes Jahr.
Hass hat in einem Rechtsstaat keinen Platz – weder heute noch morgen
Intoleranz bedroht nicht nur die Direktbetroffenen: Wie alle Formen von Diskriminierung, die auf Vorurteilen beruhen, stellt Antisemitismus einen Angriff auf unsere Grundfreiheiten und unsere kollektive Sicherheit dar. Hass und Unterdrückung haben in Rechtsstaaten keinen Platz – so auch nicht in der Schweiz, einem Land der gelebten Gegensätze, das von Vielfalt geprägt ist und dank Kompromissen gedeiht.
Diese Überzeugung begleitet mich als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die 57 Teilnehmerstaaten und 11 Partnerländer vereint. Konsens ist der Leitsatz der OSZE: Aktuell stellt er angesichts der Differenzen zwischen den Mitgliedern eine Herausforderung dar. Gleichzeitig ist er aber eine Chance, da er zum Dialog zwingt.
Die Schweiz ist das erste Land, das den OSZE-Vorsitz zum dritten Mal innehat. Den Fokus ihres Vorsitzes legt sie auf die Handlungsfähigkeit der Organisation und die Verteidigung der Grundprinzipien, insbesondere die kooperative Sicherheit, die Achtung der Grundfreiheiten und der nationalen Minderheiten sowie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Um die OSZE bekannter zu machen, finden im Verlauf dieses Jahres vier thematische Konferenzen in der Schweiz statt, und im Dezember 2026 kommen meine Amtskolleginnen und -kollegen zum Treffen des Ministerrats nach Lugano.
Die erste Konferenz mit dem Titel «Bekämpfung von Antisemitismus: Bewältigung der Herausforderungen von Intoleranz und Diskriminierung» findet am 9. und 10. Februar 2026 in St. Gallen statt. Sie wird die Verpflichtungen bekräftigen, die in der OSZE-Erklärung gegen Antisemitismus verankert sind, welche im Jahr 2014 unter Schweizer Vorsitz verabschiedet wurde.
Besser verstehen, besser handeln
An dieser Konferenz werden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und internationalen Institutionen, Fachpersonen und Akteure der Zivilgesellschaft ihre Erfahrungen austauschen, um das staatliche Handeln faktenbasiert auszurichten.
Bildung, Dialog und Sport fördern die Prävention. Diese Bereiche sind Hebel zum Abbau von Vorurteilen – vor allem bei jungen Menschen, die dem Hass im Internet stärker ausgesetzt sind. Stadien und Sportveranstaltungen sind Orte, an denen Aggressionen entstehen können, die gleichzeitig aber auch zur Sensibilisierung und Inklusion beitragen.
Ich danke dem Kanton St. Gallen für seine Unterstützung bei der Organisation dieser Konferenz. Zwanzig Jahre nach der St. Galler Erklärung für das Zusammenleben der Religionen und den interreligiösen Dialog bekräftigt der Kanton sein Engagement für die friedliche Koexistenz verschiedener Weltanschauungen. Ausserdem gratuliere ich der Gamaraal Foundation, die kürzlich mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnet wurde (229 Bewerbungen aus 32 Ländern). Die Schweizer Stiftung setzt sich für die Überlebenden des Holocaust und ihr Gedenken ein.
Wir müssen der Erinnerung Taten und Versöhnung folgen lassen. «Denket, dass solches gewesen», erinnert uns Primo Levi. «Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen.» Frieden ist weder ein Ideal noch eine Ideologie, sondern eine tägliche Aufgabe.
Ignazio Cassis, Bundesrat