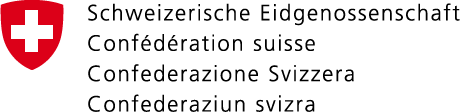«Resultat von viel Kampf und Ringen»
Im Dezember 2024 entscheidet die UNO-Generalversammlung über die neue Konvention zur Cyberkriminalität. Die Schweizer Delegation wurde an den Verhandlungen über die Konvention vom EDA und EJPD geleitet. Irene Grohsmann von der Abteilung Internationale Sicherheit im EDA sowie Andrea Candrian und Sara Pangrazzi, die beide im Bundesamt für Justiz des EJPD arbeiten, blicken auf die Verhandlungen zurück und ordnen das Ergebnis ein.

Interview, analog und digital: Gespräch über die Verhandlungen über die UNO-Konvention zur Cyberkriminalität mit Irene Grohsmann (AIS, r.) und Andrea Candrian und Sara Pangrazzi (Bundesamt für Justiz, Bildschirm). © EDA
Nach zweieinhalb Jahren wurden im August 2024 die Verhandlungen über die UNO-Konvention zur Cyberkriminalität im Konsens abgeschlossen. Was hat man damit erreicht?
Irene Grohsmann (IG): Zum ersten Mal konnte auf UNO-Ebene eine Konvention zum Thema Cyberkriminalität verabschiedet werden. Dass die Konvention am Ende sogar im Konsens verabschiedet werden konnte, ist ein Erfolg für den Multilateralismus.
Sara Pangrazzi (SP): Das Resultat ist umso eindrücklicher, wenn man die Ausgangslage betrachtet: Die Positionen lagen zu Beginn weit auseinander. Bereits die Sondierungsgespräche haben Zeit gebraucht, bevor man überhaupt in die Substanz gehen konnte. Bis zum Schluss gab es unterschiedliche Meinungen. Das Ergebnis ist folglich ein hart erarbeiteter Kompromiss, der verschiedenen Ansichten und teilweise sogar divergierenden Rechtssystemen Rechnung tragen musste.
Was umfasst die ausgehandelte Konvention?
Andrea Candrian (AC): Das Übereinkommen hat drei Stossrichtungen: Zum einen geht es um die Kriminalisierung durch die Mitgliedstaaten, dann um prozedurale Fragen: Was sehen Staaten innerstaatlich vor, um Delikte und Cyberkriminalität zu bekämpfen? Die dritte Stossrichtung betrifft die internationale Kooperation: Wie Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Cyberkriminalität zusammenarbeiten.

Die Schweiz hat 2019 die Resolution nicht unterstützt, welche die Verhandlungen über die UNO Konvention zur Cyberkriminalität initiiert hat. Was war der Grund für die Skepsis?
IG: Es wurde befürchtet, dass mit einer UNO-Konvention das heutige Schutzniveau unterschritten werden könnte. Denn es gibt ja bereits eine Konvention zur Cyberkriminalität: die so genannte Budapest-Konvention des Europarats, die die Schweiz ratifiziert hat. Es war nicht absehbar, ob auf UNO-Ebene vergleichbare Standards definiert werden können, wie sie in der Konvention des Europarats auf regionaler Ebene gelten.
Weshalb hat die Schweiz dann doch mitgemacht, als 2022 die Verhandlungen begannen?
IG: Für die Schweizer Delegation war klar: Wenn der Verhandlungsprozess auf UNO-Ebene tatsächlich aufgenommen wird, machen wir mit. Nur so können wir unsere Ansichten einbringen und die für die Schweiz wichtigen Elemente sichern. Immerhin handelt es sich um eine UNO-Konvention. Dazu kommt, dass die Schweiz als aktives Mitglied der UNO multilaterale Prozesse grundsätzlich mitgestalten und wo möglich unterstützen will.
Und hat es sich aus Ihrer Sicht gelohnt, an den Verhandlungen mitzumachen?
AC: Absolut. Die bereits bestehende Europarats-Konvention über die Cyberkriminalität, bekannt als Budapest-Konvention, hat fast 80 Mitgliedstaaten. Über 120 Staaten weltweit haben sich zumindest daran orientiert, wenn sie ihre Strafgesetzgebung im Bereich Cyber angepasst oder revidiert haben. Doch es ist und bleibt ein Europarats-Übereinkommen. Die UNO-Konvention gibt uns nun die Möglichkeit, weitere Partner im Kampf gegen die Cyberkriminalität zu finden – und dies auf einer Grundlage, die Verfahrensgarantien und Schutzmechanismen zugunsten der Menschenrechte festschreibt.
Welche Ziele standen für die Schweiz bei Verhandlungsbeginn im Vordergrund – und wie weit konnten sie erreicht werden?
IG: Für die Schweizer Delegation war wichtig, dass die Konvention einen klaren Geltungsbereich hat und einen klaren Katalog von Straftaten umfasst. Dieser sollte sich auf Cyberkriminalität im engeren Sinn beschränken. Im Zentrum standen für uns ausserdem die menschenrechtlichen Schutzgarantien und klare Gründe, wann die Schweiz auch eine Zusammenarbeit ablehnen kann. Nur so können unsere Behörden im Rahmen dessen arbeiten, was unsere Rechtsordnung uns erlaubt.
Was war denn am Anfang beim Begriff der Cyberkriminalität umstritten?
IG: Wenn man von Cyberkriminalität spricht, kann dies sogenannte Cyber-unterstützte Straftaten oder Cyber-abhängige Straftaten meinen. Die Schweizer Delegation hat sich dafür eingesetzt, dass sich die Konvention möglichst auf Cyber-abhängige Straftaten (sog. «core-cybercrimes») fokussiert, also Straftaten wie Hacking, die man nur mittels Informationskommunikationstechnologie begehen kann. Die Cyber-unterstützten Straftaten hingegen (d.h. Straftaten, die eine Cyber-Komponente haben können, aber nicht müssen) werden grundsätzlich in der realen Welt begangen, unterstützt mit Informationskommunikationstechnologie. Ein solches Verständnis von Cyberkriminalität würde daher viel weiter gehen. Darunter könnte z.B. auch die Planung eines terroristischen Aktes mit Mobiltelefonen fallen.
Dies hätte danach als Cybercrime gelten sollen.
IG: Genau. Verschiedene Staaten wollten diesen viel breiteren Begriff von Cyberkriminalität in der Konvention verwenden. In diesem Zusammenhang wurden auch Genozid oder Verbreitung von Nazi-Gedankengut als Straftat vorgeschlagen. Das wäre für uns zu weit gegangen. Die Konvention beschränkt sich nun grösstenteils auf die Cyber-abhängigen Straftaten. Einzig der Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung online, der eigentlich keine Cyber-abhängige Straftat darstellt, ist nun auch in der Konvention enthalten. Das ist aus unserer Sicht positiv.
Welches waren für die Schweizer Delegation die roten Linien?
AC: Eine rote Linie wäre gewesen, wenn die UNO-Konvention Verpflichtungen zur Schaffung von Strafbestimmungen umfassen würde, bei denen es massgeblich um Gesinnungen geht oder wenn «sich zusammenfinden zu einem Zweck» als staatsgefährdendes Delikt kriminalisiert werden sollte. Dass unter dem Deckmantel des neuen UNO-Übereinkommens massive Einschränkungen von Grundrechten stattfinden, wäre dann ein grosses Risiko geworden.

SP: Für die Schweizer Delegation war auch entscheidend, dass jede Strafverfolgungsmassnahme von bestimmten Schutzstandards begleitet ist, die national wie auch bei der Kooperation auf internationaler Ebene eingehalten werden müssen. Es gab zudem im Rahmen der Verhandlungen Diskussionen, das Territorialitätsprinzip, also das Verständnis von territorialer Anknüpfung aufzuweichen, weil das Internet ja über die Grenzen hinweg funktioniert. Doch die UNO-Konvention hält nun an der staatlichen Souveränität fest. Das ist wichtig für das Konzept der internationalen Rechtshilfe, die weiterhin von der Einheit «Staat» ausgeht, der mit einem anderen Staat kooperiert und dabei seine Standards prüfen und berücksichtigen kann. Dass die Schweiz bei Massnahmen im Rahmen der Strafverfolgung die bei uns geltenden rechtlichen Verfahrensgrundlagen und safeguards hätte unterschreiten müssen, wäre aus Sicht der Schweizer Delegation nicht akzeptabel gewesen.
Für die Schweiz ist im Cyber-Bereich zentral, dass die Menschenrechte, die «offline» gelten, auch «online» respektiert werden. Das wäre also bei der UNO-Konvention sichergestellt?
AC: Ja. Wir haben jetzt ein Vertragswerk im Entwurfsstadium vor uns, welches der Schweiz und ihren Rechtshilfebehörden erlaubt, die Zusammenarbeit mit anderen Staaten abzulehnen, wenn Grundrechte wie der Schutz der Menschenrechte dadurch gefährdet werden könnten.
SP: Die Schutzartikel, z.B. die konkreten Bestimmungen zu den Menschenrechten oder kooperationsrechtliche Ablehnungsgründe, waren bis zuletzt umkämpft. Einige Verhandlungsstaaten stellten sich bis zum Schluss der Verhandlung sogar gänzlich gegen die Aufnahme solcher Bestimmungen oder wollten diese deutlich abschwächen. Dass nun die Schutzartikel in der Konvention drin sind, ist das Resultat von viel Kampf und Ringen.
Verschiedene NGO haben kritisiert, dass «dank» der Konvention die Kommunikation zwischen Privatpersonen einfacher überwacht werden kann und auch der Quellenschutz von Medienschaffenden gegenüber Whistleblowern aufgeweicht werde. Ist das so?
SP: Es gibt mit Artikel 6 in der Konvention eine explizite Bestimmung, dass die Konvention nicht benutzt werden kann, um Personen aufgrund ihrer Meinung oder ihres Glaubens zu verfolgen oder andere Menschenrechte zu unterdrücken. Sollten andere Staaten diese Rechte in ihren Rechtsordnungen anders auslegen, haben wir den Schutzmechanismus der doppelten Strafbarkeit: Nur bei einem Verhalten, das auch bei uns bestraft würde, ist für uns eine Kooperation mit einem anderen Staat möglich.
Was die Frage zur «einfacheren» Überwachung betrifft: Auch in diesem Bereich hat die Konvention Bestehendes nicht komplett neu erfunden. Jede Strafverfolgungsmassnahme darf weiterhin nur im Hinblick auf ein spezifisch zu verfolgendes Verbrechen erfolgen und ist Gegenstand klarer Voraussetzungen und, wie bereits erwähnt, immer auch von Schutzklauseln begleitet. Die innerstaatlich geltenden Verfahrensrechte werden daher nicht einfach so «übersteuert».
20 Jahre sind im Bereich der Informationstechnologien eine Ewigkeit. Seit der Verabschiedung der Budapest-Konvention ist die Entwicklung bis heute weit fortgeschritten. Wo schliesst die UNO-Konvention Lücken, die sich durch die technologische Entwicklung seither geöffnet haben?
AC: Die Budapest-Konvention ist zwar schon 23 Jahre alt, doch ist sie erstaunlich aktuell. Das liegt daran, dass sie zu grossen Teilen technologieneutral formuliert und ausgearbeitet worden ist. Sie verliert sich nicht in spezifischen IT-Aktualitäten wie Spamming oder Künstlicher Intelligenz. Sie beleuchtet, was kriminalisiert werden soll, was in den Staaten verfahrensrechtlich vorgesehen ist und wie die Staaten zusammenarbeiten. Deshalb funktioniert sie nach wie vor verhältnismässig gut. Darum ist es nicht so wichtig zu fragen, welche Lücken geschlossen werden konnten. Ich sehe einen massgeblichen Mehrwert der künftigen UNO-Konvention vielmehr darin, dass wir den Kreis der involvierten Partner der Vertragsstaaten erweitern könnten. Das kann hilfreich sein für die internationale Strafverfolgung und damit für die Rechtsdurchsetzung.
IG: Der Aspekt der Technologieneutralität in der Budapest-Konvention hat dazu geführt, dass dieser auch im Straftatenkatalog der UNO-Konvention gespiegelt wurde. Das war für uns ein Erfolg.
Wie geht es nun weiter? Geht der Entwurf der Konvention nun wieder zur UNO-Generalversammlung zurück, die das Mandat zu ihrer Ausarbeitung gegeben hatte?
IG: Genau. Auf UNO-Seite hat das Komitee seine Arbeit abgeschlossen und der UNO-Generalversammlung übergeben. Im Dezember 2024 sollte die UNO-Generalversammlung dies formell verabschieden. Danach wäre die Konvention offen zur Unterschrift durch die einzelnen Staaten.
Wie geht es in der Schweiz weiter?
AC: Mit ihrer Zustimmung zum Verhandlungsergebnis hat die Schweiz noch nicht darüber entschieden, ob sie die Konvention am Ende unterzeichnet oder nicht. Die zuständigen Bundesbehörden werden den nun vorliegenden Text analysieren und dem Bundesrat einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreiten.
Das Übereinkommen tritt zudem erst in Kraft, wenn 40 Vertragsstaaten es ratifiziert haben. Erst dann kann basierend auf dem Übereinkommen zusammengearbeitet werden. Die Schweiz gehört allerdings zu denjenigen Staaten, in denen internationales Strafrecht aus einer Konvention nicht direkt anwendbar ist. Sollte die Schweiz die Konvention ratifizieren, müsste eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden, inklusive Vernehmlassung bei politischen Stakeholdern, Verbänden, Parteien oder Kantonen und Entscheidung durch das Parlament.