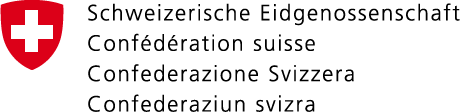«Die Schweiz kann ihre Strahlkraft nutzen – auch für den Gletscherschutz»
Der Klimawandel treibt das Abschmelzen des Eises in den Berg- und Polarregionen voran – mit potenziell verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt. Die Schweizer Polar- und Gletscherforschung gehört zur Weltspitze. Sie leistet weltweit einen substanziellen Beitrag zum Verständnis des globalen Klimawandels und trägt indirekt zum Klimaschutz bei. Prof. Daniel Farinotti, Glaziologe an der ETH Zürich, im Interview.

Sowohl in der Schweiz als auch weltweit befinden sich die Gletscher stark auf dem Rückzug, Findelengletscher im Monte-Rosa Massiv in der Schweiz. © Matthias Huss
Das EDA vertritt die Schweiz in verschiedenen politischen Gremien im Zusammenhang mit der Arktis und Antarktis und fördert so die Schweizer Polar- und Klimaforschung auf internationaler Ebene. Zahlreiche Schweizer Institutionen geniessen Weltruf für ihre wissenschaftlichen Beiträge in den Bereichen Schnee, Eis (Kryosphäre), Atmosphäre, Naturgefahren, Permafrost und Bergökosysteme.
Der Klimawandel bedroht die Kryosphäre, die gefrorenen Anteile der Erde: Gletscher, Eisschilde, Permafrost und Schnee schmelzen.
Prof. Daniel Farinotti, Glaziologe an der ETH Zürich, erklärt im Interview das Problem der Eisschmelze und wie die internationale Zusammenarbeit dagegenwirken kann.

Herr Farinotti, wie steht es um die Gletscher in der Schweiz und weltweit?
Leider gibt es hier wenig Erfreuliches zu berichten: Sowohl in der Schweiz als auch weltweit befinden sich die Gletscher stark auf dem Rückzug. Grund dafür ist die fortschreitende Klimaerwärmung, an deren Realität kein Zweifel mehr besteht. Wir stellen fest, dass der Gletscherschwund nicht nur weiter voranschreitet, sondern sich sogar beschleunigt. Das Eisvolumen aller Schweizer Gletscher ist seit dem Jahr 2000 um fast 40 Prozent zurückgegangen.
Wie kann man das Schmelzen der Schweizer Gletscher mit dem Schmelzen der Polarkappen vergleichen?
Hier ist eine differenzierte Betrachtung wichtig: Zwar sind die Ursachen, also der Klimawandel und die damit verbundenen höheren Temperaturen, dieselben, doch Ausmass, Konsequenzen und Zeitskalen unterscheiden sich deutlich. In den Schweizer Alpen kann man beispielsweise davon ausgehen, dass bis Ende des 21. Jahrhunderts der grösste Teil des Eises verschwunden sein wird. In den Polargebieten hingegen ist das zum Glück nicht zu erwarten. Auch dort werden die Gletscher erheblich an Masse verlieren, doch eine eisfreie Arktis oder Antarktis wird es im Jahr 2100 mit Sicherheit nicht geben.
Wieso ist die Erhaltung des weltweiten Eises wichtig?
Auch hier hängt die Bedeutung von der jeweiligen Region ab. In den Schweizer Alpen und anderen besiedelten Hochgebirgsregionen sind Gletscher wichtige Wasserlieferanten für Mensch und Natur, bedeutend für die Energieversorgung und ein prägender Bestandteil des traditionellen Landschaftsbildes. In den Polarregionen hingegen sind die Eismassen aufgrund ihrer schieren Grösse bestimmend für Öko- und Klimasysteme. Die Schmelzwassermengen aus diesen Regionen, insbesondere von den grönländischen und antarktischen Eisschilden, sind so gewaltig, dass sie massgeblich zum Anstieg des Meeresspiegels und zur Veränderung der Ozeanströmungen beitragen. Diese Auswirkungen sind nicht nur lokal oder regional, sondern weltweit spürbar.
Wie kann die internationale Zusammenarbeit und somit die Schweiz zum Gletscherschutz beitragen?
Obwohl die Schweiz ein kleines Land ist, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Gletscher- und Polarforschung. Dies liegt nicht nur an ihrer geografischen Nähe zu Schnee und Eis sowie ihrer langen wissenschaftlichen Tradition, sondern auch an ihrer ausgeprägten Innovationskraft. Hinzu kommen günstige finanzielle und politische Rahmenbedingungen, die die internationale Zusammenarbeit begünstigen. Diese Attraktivität wird auch international wahrgenommen und ist ein klarer Vorteil in globalen Forschungsnetzwerken. Diese Strahlkraft kann die Schweiz gezielt nutzen – auch zur Förderung des Klima- und Gletscherschutzes, welche offensichtlich auch in nicht-akademischen Bereichen einen grossen Einsatz benötigen.
Wie lautet Ihre Prognose für die Gletscher?
Für die Schweizer Gletscher bin ich leider recht pessimistisch, ihre Zukunft ist weitgehend vorgezeichnet, sie werden weiter deutlich an Masse verlieren. Zwar ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn wir können den zukünftigen Klimaverlauf noch beeinflussen, wenn wir unsere Treibhausgasemissionen konsequent senken. Würde sich die Erderwärmung gemäss dem Ziel des Pariser Klimaabkommens bei 1,5–2,0 Grad Celsius stabilisieren, wäre es möglich, noch mindestens einen Viertel des Eises in der Schweiz zu erhalten.
Auf globaler Ebene können die entscheidenden Weichen, also die Treibhausgasemissionen und die Faktoren, welche diese bestimmen, noch gestellt werden. Ich hoffe sehr, dass die zahlreichen Weckrufe sowohl aus der Forschung als auch aus der Natur endlich Gehör finden. Künftige Generationen würden es uns danken.
Ende Mai 2025 fand in Dushanbe, Tadschikistan, eine internationale Konferenz der UNO zur Erhaltung der Gletscher statt. 2025 wurde als Internationales Jahr der Erhaltung der Gletscher ernannt, was später zur Ausrufung des UNO-Jahrzehnts für Kryosphärenwissenschaften 2025–2034 führte. Das EDA hat aktiv an der Konferenz teilgenommen, verschiedene Events mitorganisiert und wurde von Prof. Daniel Farinotti bei der Ausarbeitung der Gletscherschutzerklärung von Duschanbe unterstützt.
Klimaschutz in der aussenpolitischen Strategie 2024–2027
Die Bewältigung der Klimakrise gehört zu den zentralen Aufgaben der Innen- und Aussenpolitik. Die Schweiz setzt sich für ein wirksames internationales Klimaregime ein, das die Länder mit dem grössten CO2-Ausstoss einbindet. Sie fördert bilaterale Abkommen über Emissionsreduktionen im Ausland und solche mit Ländern, welche ihr Zugang zu geeigneten CO2 -Lagerstätten im Ausland ermöglichen, um abgeschiedene, schwer vermeidbare Emissionen permanent einlagern zu können.
Im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung setzt sich die Schweiz für Ziel 13, Massnahmen zum Klimaschutz, ein.